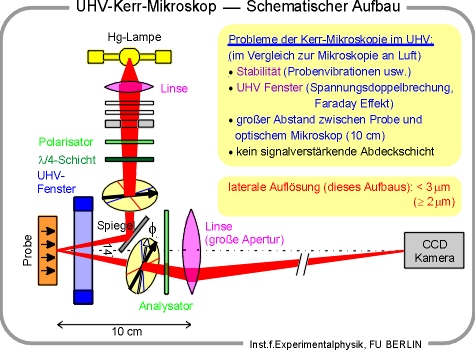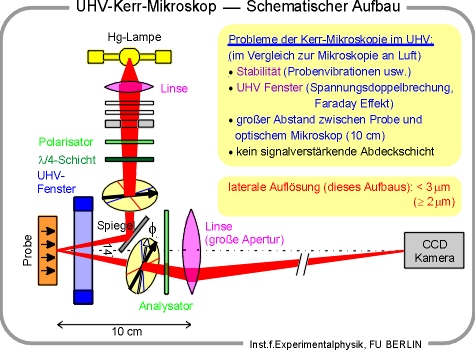Magnetische Kerr-Mikroskopie
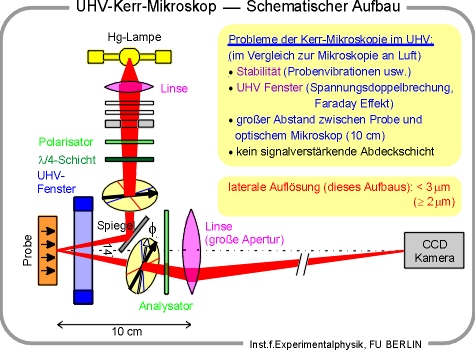
Im Vergleich zum intergralen Magnetooptischen Kerr-Effekt verwendet man
anstelle kohärenten Laserlichtes eine inkohärente Strahlungsquelle in Form einer
Quecksilber-Hochdruckdampflampe und anstelle einer Photodiode ein ortsauflösendes
Mikroskop (hier durch die Linse dargestellt) und zur Beobachtung eine CCD-Kamera.
Bei der Kerr-Mikroskopie handelt es sich an Luft um ein klassisches Verfahren.
Beim Übergang zum UHV ergeben sich jedoch verschiedene Probleme:
- ein großes Problem stellen Probenvibrationen dar. Da die Probe im UHV, der
optische Aufbau aber außerhalb der Vakuum-Kammer liegen, können beide Teile
nicht starr miteinander verbunden werden.
- besondere Aufmerksamkeit ist dem UHV-Fenster zu widmen, da es die Polarisation
des Lichtes aufgrund des Faraday-Effektes verändern könnte.
- Wegen des UHV - Luft - Überganges ist der minimale Abstand zwischen der
Probe und dem Mikroskop deutlich größer und damit beugungsbedingt die Auflösung
geringer als an Luft. Die Vakuum-Kammer wurde so optimiert, daß die Probe in der
Kerr-Mikroskop-Meßposition möglichst dicht an das UHV-Fester herangefahren werden
kann. Deswegen und durch die Beleuchtung über einen Spiegel konnte ein
Probe-Mikroskop-Abstand von nur 10 cm realisiert werden. Durch Verwendung eines
Mikroskopes mit großer Apertur beträgt deswegen die theoretisch erreichbare
Auflösung knapp 2 10-6m. Die kleinsten von mir beobachteten
magnetische Domänen waren etwa 3 10-6m groß.
- Im Gegensatz zu Anwendungen an Luft können signalverstärkende
Abdeckschichten nicht verwendet werden, da sie die dünnen Filme zerstören würden.
Um trotz des geringen Kontrastes dennoch aussagekräftige Domänenbilder zu
erzielen, bedarf es einer speziellen Bildverarbeitung, siehe
Differenzbildtechnik.